Werksreferentin Monika Rieger berichtete im Stadtrat über ihre Tätigkeit

In der jüngsten Stadtratssitzung berichtete die Werksreferentin Monika Rieger über ihre Tätigkeit als Werksreferentin. Sie gab einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen.
Zu ihren ersten Aufgaben dieser Tätigkeit gehörte es, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen – sie hatte die Gelegenheit, sich die technischen Einrichtungen und Abläufe vor Ort anzuschauen und auch einige Mitarbeitende kennenlernen.
Die Werkausschuss-Sitzungen, die fünfmal pro Jahr stattfinden, sind ein zentrales Gremium für die Entscheidungsfindung und strategische Ausrichtung der Stadtwerke. Rieger berichtete, dass diese Sitzungen oft von intensiven Diskussionen und wichtigen Entscheidungen, geprägt waren. Im Fokus stand dabei oft das Badria. „Die Schließzeiten im Lockdown und weitere Coronabeschränkungen haben zu Einnahmeverlusten geführt, das Umsetzen der Hygienevorschriften hat den Mitarbeitenden viel abverlangt“, so Rieger weiter.
Die Organisation von Veranstaltungen wie dem Badrialauf, dem Flohmarkt und dem Wettrutschen haben gezeigt, wie wichtig es sei, die Bedürfnisse der Besucher im Blick zu haben.
Ein weiteres großes Anliegen von Monika Rieger ist die Sicherheit im Schwimmbad. „Alle Besucher sollen sich sicher fühlen“. Deshalb habe sie mit Betriebsleiter Alois Harrasser ein ausführliches Gespräch zum Thema sexualisierte Gewalt geführt. Mittlerweile gibt es zu diesem Thema eine Verfahrensanweisung und jeder Mitarbeitende weiß bei einem entsprechenden Vorfall, was zu tun ist und wie die Meldekette zu funktionieren hat. „Damit es erst gar nicht so weit kommt, werden die Reinigungskräfte und das Aufsichtspersonal regelmäßig geschult“, erklärte Monika Rieger.
Ein weiteres wichtiges Thema sei die technische Wartung und Instandhaltung des gesamten Badria-Komplexes. Im August 2023 gab es einen Schaden am Freibecken, der schnell behoben werden konnte. Im Oktober 2023 kam es zu einem Brand in der Stollensauna. Durch das beherzte Eingreifen einer Mitarbeiterin konnte Schlimmeres verhindert werden. Um zukunftsfähig zu sein, brauche es nach Meinung der Werksreferentin mehr, nämlich eine Kombination aus nachhaltigen Anpassungen, technischen Modernisierungen und einen guten Blick darauf, was die Besucher sich wünschen – „aber all das kostet viel Geld“.
Nicht vergessen dürfe man, dass das Badria nicht nur ein Schwimmbad, sondern auch ein Besuchermagnet für die Stadt sei. Die Dreifachturnhalle biete Platz für Sportveranstaltungen, Künstlermarkt, Briefmarkentauschtag oder Konzerte.
2023 wurde der 45. Geburtstag des Badria gefeiert, doch die Mitglieder des Werkausschusses müssen sich fragen, wie es mit dem bald 50jährigen Badria weitergehen wird. Dabei müsse man das Familienbad, das Freibad mit dem Freigelände und den Wellnessbereich differenziert betrachten. „Können und wollen wir uns als kleine Stadt weiterhin ein so großes Bad überhaupt leisten“, so Rieger. Um zu solchen Entscheidungen zu gelangen, seien viele Überlegungen und Gespräche mit den Verantwortlichen in den zuständigen Gremien nötig. Vielen Bad-Besuchern sei zudem nicht klar, dass das Badria zu den Stadtwerken gehöre.
Man könne davon ausgehen, dass Gas und Öl teurer werden. Die Co2-Abgabe steige jedes Jahr und weil immer mehr Kunden auf Eigenproduktion setzen und neue, energieintensive Verbraucher wie E-Autos und Wärmepumpen eine verlässliche Beschaffungsprognose immer schwieriger gestalten, steige auch das Risiko der Stadtwerke bei der Energiebeschaffung.
Sehr „bemerkenswert“ sei die Tatsache, dass sich seit Jahren Bürger engagiert darum bemühen, dass die Klimaschutzziele der Stadt Wasserburg umgesetzt werden. Ein zentrales Thema dabei sei die Frage, wie die Energieversorgung zukünftig gestaltet werden könne.
Ein weiteres wichtiges Ziel sei die Förderung von Speichertechnologien, um die Netzstabilität zu gewährleisten und um überschüssigen Strom effizient nutzen zu können. „Hier sehen wir großes Potential für die Zukunft und werden uns intensiv mit diesen Themen beschäftigen“, führte Monika Rieger aus.
Rieger dankte allen Beschäftigten der Stadtwerke für ihre Arbeit und Offenheit. Die enge Zusammenarbeit mit dem Badria-Betriebsleiter Alois Harrasser, dem ehemaligen Werkleiter Robert Pypetz und dem jetzigen Werkleiter Uwe Horn zeige ihr, dass gemeinsam viel erreicht werden könne.
Drei Punkte seien ihr besonders wichtig – der Zusammenhalt der Stadtwerke-Familie, dazu gehöre auch das Badria, die Gewinnung von Neukunden im Strombetrieb und dass die Transformation in Richtung Klimaneutralität weiter vorangetrieben werde.
Rieger schloss ihren Vortrag mit den Worten „Mein grünes Herz schlägt jetzt noch kräftiger als vor drei Jahren – für die Stadtwerke Wasserburg.“
Bürgermeister Michael Kölbl dankte Monika Rieger für den Bericht und die gute Zusammenarbeit. Als „positives Vorbild“ und hervorragende Werksreferentin beschrieb Friederike Kayser-Büker (SPD) ihre Stadtratskollegin. Und Georg Machl (CSU) fügte an „Mach weiter so“.
TANJA GEIDOBLER / Bild: Rieger
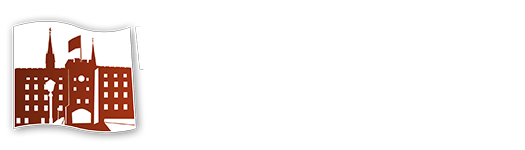

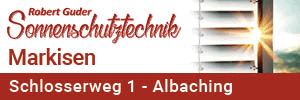
Kann es etwas Schöneres geben, als grüne Werkreferentin in Wasserburg zu sein? Wohl kaum. Keine Kommune in weitem Umkreis hat auch nur ähnlich gute Voraussetzungen, ihre Bürger und Unternehmen mit kostengünstiger und klimaneutraler Energie zu versorgen. Eigene Flächen für Windenergie und PV, Wärme aus dem Inn oder aus industrieller Abwärme, eine eigene Bank. Bessere Bedingungen kann man sich kaum vorstellen, um sie mit den Stadtwerken in konkrete Projekte umzusetzen.
Passieren wird das nach dem Willen unseres Stadtrats allerdings nicht. In den nächsten 5 Jahren wird es nahezu keine Investitionen in Energieprojekte geben, Bürger und Unternehmen werden mit den ab 2027 anstehenden, drastisch steigenden Heizkosten allein gelassen.
Dadurch werden auch die Stadtwerke weiter ein hoch defizitäres Unternehmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell bleiben, das jedes Jahr Millionen an frischem Geld von der Stadt braucht.
Man könnte noch darüber diskutieren, ob Monika Riegers Haltung zur zukünftigen Energieversorgung verantwortungsvoll ist oder nicht. Mit grünen Positionen ist sie schlicht unvereinbar und es wäre an der Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen.
In der Hofstatt wäre noch jede Menge Potential für PV und Solaranlagen. Die neue Gestaltungssatzung macht‘s möglich. Die Eigentümer müssen nur wollen. Ein jeder kehr vor seinem Tor, oder anders ausgedrückt, wer mit dem Finger auf andere zeigt, bei dem zeigen vier auf ihn selbst.
Überschüssige Energie nutzen. Sie bringt es auf den Punkt, warum deutsche Geister nie in der Lage sein werden, den Planeten zu schützen. Wenn man in grüne Energie investiert, wird man zwar sehr gelobt, was manchen Menschen überaus gut tut. Aber es bleibt halt der schlimme Gedanke, dass im Juli um 14:00 Uhr der Strom in die Leitung geht und „mein“ Investment den „anderen“ zur Verfügung steht und das ist sowas von Gemein. Was also tun? Genau, Überschuss nutzen. Und da gibt’s nur eins: Kaufen, kaufen, kaufen. Dinge kaufen, die den Überschuss verbrauchen und dass das Produkt bei der Produktion den Planeten belastet hat, ist mir doch sch… egal. Hauptsach die anderen kriegen nichts von meinem Investment ab. Und wenn ich 3x im Jahr in Urlaub bin, weil ich toller grüner Hecht, hab es mir echt verdient, dann müssen die Verbraucher laufen. Am besten viel smart Home Elektronik aus Fernost einschiffen lassen, damit das alles zur richtigen Stunde verbraucht wird und die Klimaanlage mit extrem klimaschädlichem Kältemittel ist ja auch schon da, dann kann man das Haus ja kühlen für Hund und Katz. So ist das, im Land der Denker…
Ja, die lieben PV Anlagen Besitzer, wie sie doch für die Allgemeinheit sorgen. Zum einen lassen sie sich ihre Anlage von allen anderen, die meist keine Möglichkeit für eine derartige Anlage haben mitfinanzieren. Zum Anderen sorgen Sie für steigende Strompreise. Denn obwohl Sie wesentlich weniger „öffentlichen“ Strom benutzen, die Infrastruktur hierfür benötigen sie in den schlechten Sonnenzeiten dennoch. Das der überschüssige Strom der Mittagszeit, der dann eigentlich wie Müll gehandelt wird teuer bezahlen werden muss lassen wir mal Außen vor. Denn Nachts wird der Müll vom Mittag zu Gold, und wir kaufen wir diesen teuer zurück.
Wir haben ganz einfach ein Speicherproblem. Der erzeugte Solarstrom wird nicht verbraucht und kann auch nicht in den Dimensionen gespeichert werden, wie er erzeugt wird. Das Zauberwort heisst Pumpspeicherkraftwerke! Die Österreicher bauen so eines gerade am Kühtai bei Innsbruck! Da läuft das Wasser zwischen zwei künstlichen Stauseen hin und her. Bei Bedarf wird Strom erzeugt, wenn dieser im Überfluss vorhanden ist, wird das Wasser wieder hochgepumpt. Kostet halt Landschaft und Wasser, aber irgendeinen Tod wird man sterben müssen. Wäre bei uns nicht möglich. Der Versuch bei Passau eins zu bauen, scheiterte schon bei der Machbarkeitsstudie an heftigen Bürgerprotesten. Am Sonntag sendete der BR einen Bericht über den Bau des sog. Südost-Links, die Stromtrasse, die den Windstrom aus dem Norden nach Südbayern transportieren soll. „Billige“ Freileitungen wollten die Bürger nicht, MP Seehofer nahm die Proteste ernst, jetzt werden die Trassen für ein Vielfaches an Kosten eingegraben. Der Landschaftsverbrauch dafür ist riesig. Dazu kommen Bauernproteste, weil die Leitungen den Boden erwärmen, diesen möglicherweise vermehrt austrocknen und dadurch das Bodenleben negativ beeinträchtigt wird. Die Zukunft wird zeigen ob die Bauern mit ihren Befürchtungen Recht behalten werden. Wie auch immer, es wird immer schwieriger, Lösungen für unseren zunehmenden Stromhunger zu finden. PV-Anlagen ohne Speicher werden‘s nicht schaffen. Und noch was: der Verbrauch an Lithium und anderen seltenen Erden für den Stromspeicherbedarf sprengt schon jetzt alle Dimensionen. Allein was für die E-Autos benötigt wird, dazu jede Menge Kleinakkus für Werkzeuge, Geräte und Smartphones.
Da haben wir ein Riesenterrain für deutschen Innovations- und Erfindergeist. Ich bin gespannt, wer das Ei des Kolumbus in Sachen Energie finden wird.
Das Zauberwort heisst CSU-getreu „Flächenversiegelung“, in diesem Zusammenhang „Landschaftsversenkung“
Denn um die von Herrn Schmid gepriesenen künstlichen Stauseen zu schaffen, werden den kommerzellen Interssen von Energiekonzernen ganze Bergtäler gewidmet, mit einer Talsperre versehen und geflutet. Und wenn sich zufällig ein Dorf darin befindet, dient das Vorhaben der Allgemeinheit, um Enteignungen zügig realisieren zu können.
Und, lieber Herr Schmid, fällt es nicht unter „Landschaftsverbrauch““, wenn eine überirdisch verlegte Hochspannungstrasse eine kilometerbreite Schnaise erfordert?
Sehr geehrter Herr oder Frau Pelton,
Freileitungen und Pumpspeicherkraftwerke verbrauchen Landschaft, das stimmt, die bestehenden Wasserkraftwerke aber auch. Beispiel: das Walchenseekraftwerk „trocknet“ die obere Isar und den Rißbach aus. Der Inn ist bis auf ein kleines Stück bei Kraiburg zu einem Kanal geworden. Zugegeben, die Stauseen und Altwässer sind Lebensräume für Vögel geworden, aber die Fischpopulation leidet unter den Stauwerken. Und das zeigt deutlich, dass es leider bei jedem Lösungsansatz die berühmte Kehrseite der Medaille gibt, darum preise ich da nichts an, sondern stelle nur Fakten fest. Photovoltaik ist ohne Speichertechnik nur bedingt eine Lösung. Wind haben wir nicht überall und ausreichend. Die AKW haben wir abgeschaltet. Kohle, Öl und Gas sind endlich und heizen die Erde weiter auf, was wir auch nicht wollen. Wasserstoff ist noch nicht serienreif. Haben Sie die Lösung für den Energiehunger moderner Industriegesellschaften gefunden? Ich nicht. Mal sehen, was unsere neue Regierung da für Ideen hat.
Lebensräume für Vögel? Wo haben sie das denn her. Die Innwerke besorgen seit Jahren dafür, dass an den Dämmen alles wie geschleckt aussieht. Es wird fleißig gemäht und abgeholzt. Da haben Insekten keine Chance und Vögel auch nicht. Die Insekten-und Vogelpopulation ist dort in den letzten Jahren extrem zurückgegangen.
Aber dafür hat man ein Zertifikat für grünen Strom. Toll.
Bei den Stadtwerken Wasserburg denke ich mir immer wieder, wie kann es sein, dass es in Wasserburg nur eine E-Ladesäule gibt die Schnellladetauglich ist. Selbst für diese eine Ladesäule beim McDonalds mit 150 KW ist schon eine untere Grenze erreicht.
Oder lassen wir das mit der E-Mobilität sein?
Verfügbarkeit Stand heute Auskunft mehrere Web Seiten zur suche nach Lademöglichkeiten.
Ein Autohändler , Staudhamer Feld, sagte mir, wir hätten gerne Leistungsfähige Ladesäulen, aber die Stadtwerke können das nicht. Für PKW wären 300KW schon das was Stand der Technik ist. Bei LKWs wie E-Actros 600 wären bis zu 1MW Ladeleistung möglich. Später sogar bis zu 3,7 MW Ladeleistung.
Da bin ich mal gespannt wie die Stadtwerke diese Leistung zur Verfügung stellen will.
Es ist schon klar, das es nicht nur an den Stadtwerken liegt, auch deren Zulieferer wird die Leistung nicht bereitstellen können.
Das Staudhamer Feld ist gar nicht im Netzbereich der Stadtwerke. Hätte der Autohändler vielleicht wissen können.
Es spielt am Ende keine Rolle wer hier der Versorger ist, Fakt ist die Leistung kann nicht bereit gestellt werden.
Die Stadtwerke bekommen den Strom auch zu einen gewissen Teil von den Bayernwerken. Es liegt an der Gesamten Infrastruktur wie Wasserburg mit Strom versorgt wird. Wenn die 110 KV Leitung die Wasserburg über das Umspannwerk an der Priener Straße versorgt nicht mehr liefert, dann gibt es eben keine Schnelllade Stationen in Wasserburg.
Es ist doch schon lange bekannt das die Leitungen an der Leistungsgrenze betrieben werden.
Wir Deutsche sind schon seltsam. Immer wieder nimmt man hier Österreich als Vorbild in allen Belangen. Ein Land, das ein AKW baut und nie in Betrieb nimmt. Ein Land mit Betonlandschaften und Schikane an LKW Fahrern, die ohne Toilette tagelang auf der Autobahn ausharren und Dosenravioli essen müssen. Ja wenn ihr sonst keine Vorbilder habt, dann kann es ja kaum aufwärts gehen hier